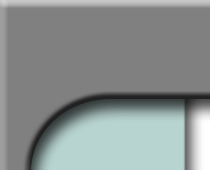|
100
Jahre Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft
1881 bis 1981
Das 19. Jahrhundert
Die Fortschritte in den Naturwissenschaften übten seit Beginn des
19. Jahrhunderts einen starken Einfluss auf die Technik aus. Wissenschaftliche
Erkenntnisse wurden in technische Einrichtungen umgesetzt, und wissenschaftliche
Untersuchungen wurden mit dem Ziel angestellt, ihre Ergebnisse technisch zu
verwerten. Durch die neuen Entwicklungen in der Technik und damit auch in der
Wirtschaft vollzog sich im Laufe der Zeit ein bedeutsamer Wandel auf vielen
Gebieten des täglichen Lebens. Im Maschinenbau waren es – um nur einige zu
nennen – die epochemachenden Schöpfungen der Schiffsschraube (Joseph Ressel, 1826/29), der
Freistrahl-Wasserturbine (Joseph
Francis, 1849), der Verbrennungskraftmaschine (Nikolaus August Otto, Eugen
Langen, 1867), des dynamoelektrischen Prinzips (Werner von Siemens, 1867), der Dampfturbine
(Carl Gustaf Patrik de Laval,
1883/84) und des Schwerölmotors (Rudolf
Diesel, 1893/97), die in diesem Jahrhundert Marksteine der technischen
Entwicklung bildeten. Nicht minder bedeutsam waren die Anwendungen der
Errungenschaften beim Antrieb von Fahrzeugen wie beim Dampfschiff (Robert Fulton, 1807), bei der Dampflokomotive
(Georg Stephenson, 1825), bei der
elektrischen Lokomotive (Werner
von Siemens, 1879) und beim Kraftfahrzeug (Carl Benz, Gottlieb
Daimler, 1885). Von diesen Neuentwicklungen hat wohl die
Dampflokomotive in technischer Beziehung dieses Jahrhundert am stärksten geprägt.
Sie und die Entstehung einer leistungsfähigen Stahlerzeugung, die wiederum durch
die Einführung der Bessemer-Birne (Sir Henry
Bessemer, 1855) gefördert wurde, waren es, die den Aufbau eines für den
sich entwickelnden Güteraustausch so notwendigen Transportmittels in Form der
Eisenbahn ermöglichten. In Deutschland, wo in diesem Jahrhundert, wenn auch sehr
spät, aus einem vielgliedrigen Staatengewirr ein Deutsches Reich mit zentraler
Regierung in Berlin entstand, entwickelte sich aus den 6 km des Jahres 1835
bis zur Jahrhundertwende ein Eisenbahnnetz von rund 50.000 km.
Der Mensch lernte alle diese Maschinen schätzen, gebrauchte sie und hielt es
schließlich für selbstverständlich, dass sie auch funktionierten. Darüber aber,
wie viel Wissen, Fleiß und Umsicht notwendig sind und wie viel Kleinarbeit
geleistet werden muss, um sie zu entwickeln, zu konstruieren, zu bauen und zu
betreiben, machte man sich keine Gedanken. Das führte auch dazu, dass der in diesen
Jahrzehnten neu entstehende Berufszweig des Maschineningenieurs nicht die ihm
gebührende Beachtung erfuhr. Dazu kam auch noch, dass der Ingenieur zumeist mit
den handarbeitenden Menschen, den Handwerkern, in Verbindung gebracht wurde. Diese
falsche Einschätzung und mangelnde Geltung des neuen Berufsstandes in Deutschland
– im Gegensatz z. B. zu England und Frankreich – veranlasste im
Dezember 1880 eine Anzahl von Maschineningenieuren aus Wissenschaft, Industrie und
Verkehr, Männer in hochangesehener selbständiger, privater und amtlicher Tätigkeit,
darunter 4 Professoren der Technischen Hochschule Berlin, 13 höhere Eisenbahnbeamte
und 20 Industrielle, in der Mehrzahl aus dem Lokomotiv- und Waggonbau, einen
Aufruf „An unsere Fachgenossen” zu erlassen, in dem festgestellt
wurde, dass trotz aller persönlicher Tüchtigkeit und Leistung des einzelnen der
Berufsstand des Maschineningenieurs bislang nicht die allgemeine Anerkennung hat
finden können. So hieß es u. a. in dem Aufruf:
|
| |
„Mit der fortschreitenden Entwicklung auf allen Gebieten des staatlichen
und wirtschaftlichen Lebens tritt mehr und mehr das Bestreben in den
Vordergrund, die Kräfte gleichartiger Interessen- und Wirkungskreise immer enger
und fester aneinander zu schließen, um durch ein größeres Zusammenhalten,
-wirken und
-handeln die Zwecke der einzelnen Kreise
in angemessener Weise zu fördern, den Gliedern derselben eine geachtete Stellung
nach innen und außen zu schaffen, und den jüngeren Elementen ein belehrendes und
anregendes Vorbild zu geben.
Das gleiche Streben hat neuerdings auch die unterzeichneten Männer der Technik
zusammengeführt und der schon lange empfundenen Überzeugung Ausdruck verliehen,
dass den deutschen Maschinen-Ingenieuren bisher die Vereinigung fehlt, welche
andere Fachkreise in so hervorragender Weise auszeichnet, und welche, von einem
zusammenhaltenden Geiste angeregt, allein imstande ist, der ganzen Berufsklasse
die Stellung zu erwerben und zu erhalten, welche dieselbe im Wettbewerbe des
täglichen Ringens und Strebens auszufüllen, ganz gewiss geeignet und berufen
ist”
|
|
|
Den führenden Technikern jener Zeit schwebte also in erster Linie vor, die
gesellschaftliche Stellung des Maschineningenieurs zu heben und ihm leitende
Stellungen auch im Staatsdienst zu öffnen.
Man rechtfertigte sich auch gegenüber dem 1856, also schon 25 Jahre früher
gegründeten „Verein Deutscher Ingenieure”. Die vom neuen Verein
gesteckten Ziele durch Initiative des alten zu erreichen, war nur ein frommer
Wunsch der Berufsgenossen, hieß es. Bei näherem Einblick in die Verhältnisse musste
man jedoch die Überzeugung gewinnen, dass die Durchführung dieser Idee, wenn nicht
unausführbar, so doch höchst schwierig und zeitraubend sein würde, indem die
Zusammensetzung und die ganze Gestaltung des alten Vereins vorher eine große
Umwälzung hätte erfahren müssen, ehe man auf dem beabsichtigten Wege weiter
vorzugehen in der Lage gewesen wäre.
Der Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure 1881 bis 1920
Der Aufruf hatte Erfolg. Am 11. März 1881 wurde in Anwesenheit von 54
Fachgenossen unter Vorsitz von Geh. Kommerzienrat Louis Schwartzkopff (1825 bis 1892) der
„Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure (VDMI)” gegründet. Die
Konstituierung erfolgte mit einer Mitgliederzahl von 137. Der Verein unterschied
zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Die ersteren mussten
30 Jahre alt sein und sich in einer selbständigen oder verantwortlichen
Stellung befinden. Für außerordentliche Mitgliedschaft wurde ein Mindestalter von
24 Jahren und akademische Ausbildung verlangt. Als Zweck des Vereins gab
§ 1 der Satzung die Förderung der gemeinsamen Interessen des gesamten
Maschinenbaufaches in technischer und wirtschaftlicher Beziehung, und zwar durch
Vorträge, Veröffentlichungen, Besichtigungen und durch Ausschreiben von
Preisaufgaben an.
Der erste Vorstand setzte sich zusammen aus
|
| |
Civil-Ingenieur Veitmeyer,
Berlin, Vorsitzender,
Direktor
Stahl, Bredow b. Stettin, 1. Vorsitzender-Stellvertreter,
Eisenbahn-Direktor Gust,
Berlin, 2. Vorsitzender-Stellvertreter,
Kommissionsrat F. C.
Glaser, Berlin, Schriftführer und Säckelmeister,
und weitere 11 Mitglieder aus Berlin, Breslau, Düsseldorf und Hannover.
|
|
|
Es waren insgesamt 7 Eisenbahn-Direktoren bzw. Maschinenmeister, 6 Industrielle,
1 Hochschulprofessor und 1 Civil-Ingenieur.
Die Geschäftsstelle des neuen Vereins befand sich in Berlin SW, Lindenstraße
80. Der Jahresbeitrag wurde auf 20 Mark festgesetzt. Als Vereinsorgan wurden
die 1877 von F. C. Glaser
ins Leben gerufenen „Annalen für Gewerbe
und Bauwesen” – später allgemein unter „Glasers Annalen”
bekannt geworden – erkoren. Der glückliche Umstand, dass von Anbeginn nahezu
30 Jahre lang bis 1910 der Säckelmeister und Schriftführer des Vereins in
Personalunion auch Herausgeber des Vereinsorgans war, hat sich für den Verein und
seine Entwicklung sehr vorteilhaft ausgewirkt.
In der ersten Mitgliederversammlung nach der Gründung fand am 8. April auch
schon der erste Vortrag statt. Es sprach Prof. Meyer, der erste Rektor der Technischen
Hochschule Berlin, über „Die Bedeutung und der gegenwärtige Stand der
Maschinentechnik”. Er wies u. a. darauf hin, dass man bisher den
Technikern im Allgemeinen nicht die Stellung einräumte, die ihnen vermöge ihres
Wissens und Könnens zukomme, dass aber insbesondere die Gruppe der
Maschineningenieure gegenüber den Architekten und Bauingenieuren am weitesten
zurückstehe. Er zitierte auch aus einer Debatte im Abgeordnetenhaus am
18. Februar 1881, wo der Abgeordnete Berger u. a. ausführte:
|
| |
„Unter den Eisenbahntechnikern aber existiert eine Spezies, welche noch
schlechter situiert ist als die Bautechniker gegenüber den Juristen, ich meine
die Maschinen-Ingenieure, diejenige Klasse der Techniker, deren großem Ahnherrn
Stephenson wir die Erfindung der Lokomotive zu verdanken haben.”
|
|
|
Nach dem geglückten Start entwickelte sich eine sehr rege Vereinstätigkeit. Bis
zu 8 Mitgliederversammlungen, zu denen auch Gäste geladen wurden und in denen nach
Erledigung der Regularien immer ein Vortrag, meist mit anschließender Diskussion,
gehalten wurde, fanden jährlich statt. Auch im Bemühen um die Hebung des Ansehens
der Maschinenbauer war dem Verein sehr schnell ein Erfolg beschieden. Wenn auch
schon z. B. am 1. Januar 1874 das erste maschinentechnische
Direktionsmitglied bei
der Bergisch-Märkischen Eisenbahn ernannt worden war und in den Jahren 1874 und 75
auch die übrigen 6 Königlichen Eisenbahndirektionen ein solches Mitglied erhielten,
so war es doch für die damalige Zeit und ihre Geringschätzung der Technik
bezeichnend, dass im Ministerium der öffentlichen Arbeiten die Maschinentechnik
nicht vertreten war. Erst für das Etatjahr 1881/82 wurde eine Ratsstelle für einen
Maschinentechniker, den Eisenbahndirektor Moritz Stambke (1830 bis 1903) geschaffen. Stambke, der bald Mitglied des Vereins wurde,
hat als oberster maschinentechnischer Beamter und später als Mitglied des
Vorstandes des Vereins für das Ansehen der Fachgenossen Außerordentliches
geleistet.
Im Jahr 1884 gab der Minister
Maybach die Erklärung ab, dass die höheren technischen Verwaltungsbeamten
ganz gleichmäßig zu behandeln seien. Es hat aber noch Jahrzehnte gedauert, bis im
Staatsdienst die Parität einigermaßen hergestellt wurde. Das spiegelte sich auch
in den Amtsbezeichnungen wider. Die Regierungs-Maschinenbauführer und
-Baumeister wurden 1886 den anderen Bauführern
gleichberechtigt und ihnen der Titel „Regierungsbauführer” und
„Regierungsbaumeister” beigelegt. Der
höhere technische Eisenbahnbeamte hatte den Titel „Bauinspektor”,
während der Jurist ein Regierungsrat war. Erst im Jahr 1910 ist es gelungen, den
Titel „Bauinspektor” zu beseitigen.
1884 veranstaltete der Verein sein erstes Ausschreiben, und ab 1887 erhielten
konstruktive Preisaufgaben zu Ehren von Christian Peter Wilhelm Beuth (1781 bis 1883), des Gründers des
Königlichen Gewerbe-Institutes, den Namen Beuth-Aufgaben, und der für diese
Aufgaben ausgesetzte Preis hieß fortan Beuth-Preis.
Für ein Vereinsandenken, wie es genannt wurde und das für besondere Verdienste,
später vor allem im Rahmen des Beuth-Preises verliehen wurde, beschloss man im Mai
1899, eine Medaille prägen zu lassen, die das Bild von Beuth trägt. Als Vorbild für die Prägung
diente die in der National-Galerie befindliche Büste Beuths von Christian Daniel Rauch (1777 bis 1857). Die neue
Beuth-Medaille wurde erstmals 1899 für preisgekrönte Arbeiten des
Beuth-Ausschreibens 1898 verteilt.
Zu den Aufgaben, die sich der Verein stellte, gehörte auch die Regelung der
Ausbildung in Theorie und Praxis. Hierbei galt es vor allem, auch der stürmischen
Entwicklung der Maschinentechnik in diesen Jahren Rechnung zu tragen. Man machte
sich Gedanken und Vorschläge über Dauer und Art des Praktikums, die Dauer der
Studienzeit, die weitere Ausbildung im Staatsdienst als Konstrukteur,
Abnahme-Kommissar, Betriebs- und Werkstätten-Beamter, in der Privatindustrie als
Konstrukteur und Betriebsleiter für bestimmte Branchen.
Es gab wohl schon seit dem 18. Jahrhundert Polytechnische Schulen. Aus ihnen
gingen in vielen Fällen die Technischen Hochschulen hervor. Am Gründungsort des
Vereins, in Berlin, wurde 1879 die „Königliche technische Hochschule zu
Berlin” gegründet. Akademische Grade für Ingenieure gab es aber nicht. Eine
besondere Aufwertung erfuhren die Technischen Hochschulen Preußens, als ihnen am
15. Juni 1898 Sitz und Stimme im Herrenhaus verliehen wurde. Mit Erlass vom
11. Oktober 1899 erhielten sie dann in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen
Bedeutung vom König von Preußen das Recht eingeräumt, den Grad eines
Diplom-Ingenieurs (Dipl.-Ing.) zu erteilen, Diplom-Ingenieure auf Grund einer
weiteren Prüfung zu Doktor-Ingenieuren (Dr.-Ing.) zu promovieren und die Würde
eines Doktor-Ingenieurs Ehren halber (Dr.-Ing. E. h.) als seltene Auszeichnung
an Männer zu verleihen, die sich um die Förderung der technischen Wissenschaften
hervorragende Dienste erworben haben. Auch an dieser Entwicklung hatte der Verein
seinen Anteil, sah er doch von Anfang an eine seiner wichtigsten Aufgaben in der
Gleichstellung der Technischen Hochschulen mit den Universitäten.
Ein bemerkenswertes Datum für den noch jungen Verein war der 5. Dezember
1898, an dem der Kaiser ihm die Rechtsfähigkeit verlieh. Der Allerhöchste Erlass
lautete:
|
| |
Auf den Bericht vom 24. November d. J. will Ich dem „Verein
Deutscher Maschinen-Ingenieure” in Berlin auf Grund der hierneben
zurückfolgenden Satzung vom 22. September 1898 die Rechte einer
juristischen Person verleihen.
Potsdam, den 5. Dezember 1898.
gez. Wilhelm
ggez. Thielen, Schönstedt, Frhr. von der Recke,
Brefeld.
|
|
|
In der daraufhin am 28. Februar stattfindenden Versammlung wurde als
Nachfolger von Veitmeyer (1820 bis
1899), der somit 18 Jahre die Geschicke des Vereins geleitet hat, Geheimer
Oberbaurat Wichert (1843 bis 1921)
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Veitmeyer, der wenige Tage vorher, am
3. Februar 1899 starb, hinterließ dem Verein 30.000 Mark mit der Bestimmung,
dass die Zinsen des Kapitals dazu verwendet werden sollten, Preisaufgaben zu
stellen und erfolgreiche Bearbeiter mit Geldpreisen auszuzeichnen.
Dem zielbewussten Streben der Ingenieure, die den Verein gegründet und mit Leben
erfüllt haben, verdankte er seine ausgezeichnete Entwicklung. In das 25. Jahr
seines Bestehens, dessen am 10. und 11. März 1906 im großen Konferenzsaal des
Anhalter Bahnhofs und in den Räumen der Gesellschaft der Freunde zu Berlin mit
Festveranstaltung, Kommers und Festball gedacht wurde, trat er mit 541 Mitgliedern
ein. In dem aus diesem Anlass vom damaligen 1. Vorsitzenden, dem inzwischen
zum Oberbaudirektor avancierten Wichert abgegebenen Rechenschaftsbericht kam
das erfolgreiche Wirken des Vereins und der Stolz auf die hohe Anerkennung zum
Ausdruck, die er bei den Behörden und der Industrie sowie in wissenschaftlichen
Kreisen gefunden hat, was nicht zuletzt aus der großzügigen Unterstützung, die der
Verein erfuhr, zu erkennen war. Das Vermögen betrug zu diesem Zeitpunkt 70.000 Mark.
Den Höhepunkt der 25-Jahr-Feier bildete die Verleihung der Würde eines Dr.-Ing.
E. h. an den 1. Vorsitzenden Wichert durch die Technische Hochschule
Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um die Ausbildung des deutschen
Eisenbahn-Maschinenbaues.
Galten die ersten 25 Jahre der Hebung der gesellschaftlichen Stellung des
Maschinentechnikers, so waren die folgenden 25 Jahre mehr dem wissenschaftlichen
Ausbau gewidmet. Die vielen Vorträge, die gehalten und zum größten Teil in Glasers
Annalen veröffentlicht wurden, befassten sich nicht nur mit allen Gebieten der
Maschinentechnik, sondern erstreckten sich auch auf deren Nachbargebiete. Im
Bemühen, die technische Entwicklung in der Welt laufend zu verfolgen, wurden aus
den Mitgliedern besonders geeignete Sachverständige ausgewählt, die auf Kosten des
Vereins zu Welt- und Sonderausstellungen entsandt wurden, um anschließend in den
Mitgliederversammlungen über ihre Eindrücke und neuen Erkenntnisse zu berichten.
Man bezog Fachzeitschriften, die den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden,
und förderte die Herausgabe von Fachbüchern. So erhielt schon 1904 Geheimer
Regierungsrat Professor August Friedrich Wilhelm von Borries (1852 bis 1906), seit 1902
Professor für Verkehrsmaschinenwesen an der Technischen Hochschule Berlin, 6.000
Mark als Beihilfe für die Abfassung eines Lehrbuches über den Lokomotivbau. Seine
Mitarbeiter waren Professor Dr. Sommerfeld und Dipl.-Ing. Berner.
Für dieses umfassende Wirken des Vereins, zu dem noch laufend Ausschreiben
aktueller Aufgaben mit hierfür ausgesetzten Preisen kamen, wurde natürlich Geld
benötigt. Die laufenden Beiträge genügten nicht. Hier half, abgesehen von
Unterstützungen einzelner Mitglieder, in großzügiger Weise die Industrie. So wurden
anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im Jahre 1906 von der Deutschen
Radsatz-Gemeinschaft 10.000 Mark zur Förderung der Bestrebungen des Vereins
gestiftet. Die Norddeutsche Wagenbau-Vereinigung hat zur Förderung der
Vereinszwecke, insbesondere für die Erteilung von Preisen, jahrzehntelang jährlich
3.000, später 5.000 Mark zur Verfügung gestellt. Das gleiche taten die
Lokomotivfabriken. Auch die Elektroindustrie half mit, nur um einige Beispiele zu
nennen.
Am 10. Mai 1913 beging der 1. Vorsitzende des Vereins seinen
70. Geburtstag. Das nahm die Norddeutsche Wagenbau-Vereinigung zum Anlass, an
den Verein in Anerkennung der Verdienste des Jubilars um die Hebung des
Eisenbahnwagenbaus 20.000 Mark als Grundstock zu einer Wichert-Stiftung zu
überweisen. Als Zweck der Stiftung wurde festgelegt, dass aus den Zinsen des
Kapitals einmalige oder laufende Beihilfen an Studierende des Maschinenbaus oder
der Elektrotechnik gewährt werden.
Als der Wirkliche Geheime Oberbaurat Dr.-Ing. E. h. Carl Müller (1847 bis 1929) im Jahre 1917 aus dem
Staatsdienst ausschied, legte der Norddeutsche Lokomotiv-Verband in Anerkennung der
von Müller dem Vaterland auf dem Gebiet des Lokomotivbaus und damit auch der
einschlägigen Industrie geleisteten Dienste mit 30.000 Mark den Grundstock für eine
Müller-Stiftung. Mit ihren Zinserträgen sollten, wie bei der Wichert-Stiftung,
Beihilfen an Studierende gewährt werden, es sollten aber auch Ingenieure bedacht
werden, die sich besonders auf dem Gebiet des Lokomotiv-Baus und der
Lokomotiv-Konstruktion verdient gemacht und hervorgetan haben.
Der 1. Weltkrieg blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Vereinsleben. Ein
großer Teil der Mitglieder wurde eingezogen, der Besuch der Versammlungen ließ
nach, die Veröffentlichungen der Vorträge wurden vielfach vom Oberkommando nicht
freigegeben, die Ausschreiben fanden keine Bearbeiter. 1919 mussten wegen der
politischen Unruhen die Versammlungen für einige Zeit ausgesetzt
werden.
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 1920 bis 1945
Nach dem Krieg bahnte sich für den Verein eine tiefgreifende Änderung an. Es
wurde eine neue Wahlordnung herausgebracht und eine neue Satzung erarbeitet. Mit
der Genehmigung der neuen Satzung durch den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg
und von Berlin mit Datum vom 5. Juni 1920 änderte der Verein Deutscher
Maschinen-Ingenieure seinen Namen in
Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft.
Der Vorstand setzt sich nunmehr aus dem
|
| |
1. Vorsitzenden
2. Vorsitzenden
3. Vorsitzenden
1. Schriftführer
2. Schriftführer
Säckelmeister
Stellvertreter des Säckelmeisters
|
|
|
und 8 weiteren Mitgliedern zusammen. Ferner sah die neue Vereinsordnung die Wahl
eines Rechnungsausschusses, eines Technischen Ausschusses und eines
Geselligkeitsausschusses vor. An der Einsetzung dieses Ausschusses ist die große
Bedeutung zu entnehmen, die die Gesellschaft, wie schon bisher, in der Zukunft dem
gesellschaftlichen Leben und der Pflege eines kollegialen
Zusammengehörigkeitsgefühls beimaß, im Geiste eines Aristoteles, der das Vergnügen
als Labsal nach Mühe und Arbeit, als Heilmittel gegen den Zerfall der Kräfte
betrachtete.
Zum 1. Vorsitzenden nach der neuen Satzung wurde am 7. Dezember 1920
Baurat Dipl.-Ing. Gustav de Grahl gewählt.
Von den Erschütterungen der ersten 20er Jahre mit Wirtschaftskrise und
Geldentwertung blieb auch die DMG nicht verschont. Die Verfolgung der
Gesellschaftsziele bereitete den Verantwortlichen in diesen Jahren große Sorgen.
Der Verlag der Annalen, die sehr unregelmäßig erschienen, musste das Organ zwei
Jahre ohne Zuschüsse weiterführen. Während das Vereinsvermögen vor dem Krieg noch
einen Stand von 170.000 Mark hatte, war es 1926 auf 4.250 Reichsmark
zusammengeschrumpft. Wenn diese schweren Zeiten doch gut überstanden wurden und die
DMG 1931 in repräsentativer Form unter dem Vorsitz des Direktors und Mitglieds des
Vorstandes der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, Dipl.-Ing. Gustav Hammer (1875 bis 1961) ihr 50-jähriges
Jubiläum begehen konnte, so war das nur durch das geschickte und umsichtige Agieren
des Vorstandes, wiederum durch die Unterstützung der Industrie und durch den
selbstlosen Einsatz der nunmehr über 900 Mitglieder möglich. Es war aber nicht nur
die Mitgliederanzahl zum Zeitpunkt des Jubiläums, auf die die DMG stolz sein
konnte, sondern vor allem die Namen, die in den Mitgliederlisten der vergangenen 5
Jahrzehnte zu lesen waren, wie z. B. Julius Pintsch, Louis Schwartzkopff, Ferdinand Schichau, Oskar Henschel, Hermann Blohm, Friedrich Alfred Krupp, Sigmund Schuckert, Ernst Borsig, Rudolf Diesel, Karl Friedrich von Siemens, Namen, die der Entwicklung
des deutschen Maschinenbaus ihren Stempel aufprägten.
Die kommenden Jahre der Vereinsgeschichte wurden vor allem durch die
politischen Ereignisse im Deutschen Reich beeinflusst. Die nationalsozialistische
Gesetzgebung hat in der Verfolgung rassenideologischer Programme (Nürnberger
Gesetze 1935) und der Erfassung aller gesellschaftlichen Bereiche in starkem Maße
auch das Vereinsleben geformt. In der seit Gründung der Gesellschaft peinlich
geführten „Stammrolle”, wie die Mitgliederliste mit den persönlichen
Angaben im Vereinsjargon genannt wurde, erscheint bei Eintritten ab 1935 regelmäßig
die Eintragung „arisch”. Die Zahl der Austritte hat in diesen Jahren
stark zugenommen, sei es, dass sie notwendig wurden oder eine Konzession an den
Zeitgeist waren, sei es, dass sie Protestaktionen darstellten.
Bei Partei und Staat bestanden die Bestrebungen, alle technisch-wissenschaftlichen
Vereine einer „Reichsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen
Arbeit” (RTA), bzw. „Nationalsozialistischer Bund Deutscher
Technik” (NSBDT) anzugliedern. Die DMG konnte sich nicht entschließen, diesen
Absichten zu folgen, da keine der in der Dachorganisation vorgesehenen Fachgruppen
dem von ihr vertretenen Fachgebiet „Verkehrstechnik” entsprach. Sie
hätte durch Anlehnung an einen anderen Verein ihr Eigenleben einbüßen müssen. Diese
ganze Entwicklung störte die Harmonie in der Gesellschaft. So kam es sogar zu einem
ausgesprochenen Eklat, als der Ende 1936 praktisch einstimmig zum
1. Vorsitzenden gewählte Ministerialdirektor Dr.-Ing. E. h. Werner
Bergmann (1877 bis 1956), Leiter der
Maschinentechnischen und Einkaufsabteilung in den Eisenbahnabteilungen des
Reichsverkehrsministeriums, erklärte, die Wahl nicht annehmen zu können, solange
nicht der Anschluss an die vom Staat eingesetzte Dachorganisation vollzogen ist.
Dies geschah nicht. Nach einem kurzen Interregnum wurde Ernst Harprecht (1877 bis 1963), Vizepräsident der
Reichsbahndirektion Berlin, in einer erneut angesetzten Wahl 1938 zum
1. Vorsitzenden der DMG gewählt.
Die DMG hat sich durch ihre Widerspenstigkeit in eine schwierige Lage versetzt,
hat die kommenden Jahre aber gut überstanden und ihre Eigenständigkeit bewahrt.
Ihre Zeitschrift „Glasers Annalen” wurde jedoch im April 1943 mit der
damals ältesten deutschen, im 98. Jahrgang stehenden Eisenbahn-Zeitschrift,
dem „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens”, Fachblatt des
Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, zusammengelegt. Die Gründe waren
allerdings nicht politischer Art, die Maßnahme ergab sich vielmehr aus der
schwierigen Rohstofflage.
1944 wurde noch eine Vorstandswahl abgehalten, aus der Dipl.-Ing. Karl
Fischer (1877 bis 1958) als neuer
1. Vorsitzender hervorging.
Finanziell hatte die DMG damals keine Sorgen. Sie verfügte außerdem noch über
die Stiftungsvermögen, die inzwischen, festverzinslich angelegt, auf insgesamt
mehr als 90.000 Reichsmark angewachsen waren.
Gegen Ende des Krieges, als die Reichshauptstadt durch die Luftangriffe immer
stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde und schließlich auf sie die
Kriegshandlungen unmittelbar übergriffen, verminderte sich naturgemäß auch die
Aktivität der DMG, bis sie im Chaos der letzten Tage ganz erlosch. Immerhin
verzeichnete die Stammrolle noch am 6. Dezember 1944 den Eintritt eines
neuen Mitgliedes, des Senatspräsidenten beim Reichspatentamt Dipl.-Ing. Otto
Schultze aus
Berlin-Spandau.
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 1945 bis 1981
Wenn der Erste Weltkrieg bei der DMG nur einige Schrammen hinterließ, so waren
die Auswirkungen des Zweiten vernichtend. Die Deutsche Maschinentechnische
Gesellschaft hörte nach dem 2. Mai 1945 (Kapitulation von Berlin) auf zu
existieren, sowohl de jure als auch de facto. De jure, da durch ein
Kontrollratsgesetz der Besatzungsmächte sämtliche, auch unpolitische, Vereine
aufgelöst wurden, und de facto infolge der waltenden Lebensumstände dieser
trostlosen Zeit. Die Mitglieder waren in den vorangegangenen Monaten und Wochen
zum Teil evakuiert worden oder hatten sich abgesetzt, so mancher ist in den
Kriegswirren umgekommen. Für die wenigen, die einigermaßen die Kampftage
überstanden haben, gab es keine Möglichkeit, miteinander Kontakt aufzunehmen, denn
das große Berlin verfügte über keine Verkehrsmittel, und telefonieren konnte man
auch nicht. Schließlich hatte der einzelne in den Zeiten, in denen ein Erwachsener
u. a. mit 800 g Fleischwaren, 400 g Fett, 600 g Nährmittel,
125 g Käse für 4 Wochen auskommen und um sein weiteres Fortkommen und die
berufliche Zukunft bangen musste, andere Sorgen als an seine DMG zu denken. Es
machte sich nun, und vor allem auch in den späteren Jahren, das nachteilig
bemerkbar, was früher von ganz besonderem Nutzen für die Gesellschaft war: die
starke Konzentration von Industrie und Reichsbehörden in Berlin. War doch Berlin
die größte Industriestadt Europas, alle für die DMG wichtigen Industrieverbände
hatten ihren Sitz in Berlin, von den einschlägigen Ministerien und anderen
zentralen Reichsstellen, wie z. B. Reichspatentamt, ganz zu schweigen. Sie
alle waren, wenn nicht zerschlagen, nach dem Westen gegangen und mit ihnen viele
Mitglieder. Dort aber hatte die DMG keine Stützpunkte.
Allmählich fand unter Karl Fischer
eine kleine Gruppe zusammen. Zu ihr gehörten vor allem Dipl.-Ing. Karl Schmelzer, Oberreichsbahnrat a. D.
(1874 bis 1957), von 1938 bis 1950 Schriftleiter der Glasers Annalen und seit 1941
Ehrenmitglied, Professor Dr.-Ing. E. h. Hans Nordmann, Abteilungspräsident a. D.
(1879 bis 1957), einer der letzten großen Dampflokomotiv-Fachleute, und Dipl.-Ing.
Karl Roland (1880 bis 1965) von der
AEG. Sie bemühten sich um die Wiederzulassung der Gesellschaft als nichtpolitische
Organisation und hatten schließlich auch Erfolg: Am 24. Oktober 1949 wurde die
Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft wieder zugelassen. Dies wurde zum Anlass
genommen, am 23. November 1949 im Hörsaal 202 der Technischen Universität
Berlin in einer Sitzung den Neubeginn zu feiern.
Inzwischen hatten sich in Westdeutschland höhere Beamte der Eisenbahnen, zum Teil
ehemalige DMG-Mitglieder, zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, aus
der später die Vereinigung der Regierungsbaumeister des Maschinenwesens
„Motor” (VRM) entstand. Sie waren es, die in den schweren Jahren dem
Häuflein in Berlin in kameradschaftlicher Verbundenheit moralische Rückenstärkung
gaben, zu diesem Zweck schon 1950 einen Ausschuss für die Zusammenarbeit mit der
DMG unter Leitung des Oberreichsbahnrates Friedrich Schmidt, Dortmund, gründeten, die Berliner
zu ihren Veranstaltungen einluden und durch ihre Anteilnahme an der Entwicklung in
Berlin halfen, dass die DMG wieder zu sich zurückfand.
Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet durch Bemühungen um Aktivierung, wobei
man sich noch auf Berlin beschränkte. Dort trafen sich nicht viel mehr als ein
halbes Dutzend Männer in zeitlich unregelmäßigen Abständen im provisorischen Heim
des befreundeten, inzwischen auch wieder erstandenen Akademischen Vereins Hütte
e. V. Man versuchte recht und schlecht mit Unterstützung der Georg Siemens
Verlagsbuchhandlung in der Nollendorfstraße die Geschäfte zu führen. Dem Verlag mit
seinem rührigen Prokuristen Ernst Krull (1907 bis 1970) war es schon vor der
Währungsreform gelungen, „Glasers Annalen”, das Organ der DMG, seit
Januar 1947 wieder erscheinen zu lassen. Es fanden Besichtigungen Berliner
Industriebetriebe, Versammlungen und gesellige Zusammenkünfte statt. Man war vor
allem auch bestrebt, das Beuth-Ausschreiben wieder ins Leben zu rufen. Unter der
Leitung von Prof. Nordmann wurden
sieben Aufgaben erarbeitet und zur Diskussion gestellt. In der nüchternen
Erkenntnis, dass allein und von Berlin aus wenig zu erreichen war, arbeitete man
eng mit der VRM in Westdeutschland zusammen. Nachdem es den gemeinsamen Bemühungen
schließlich gelungen war, alle notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, wurde von
DMG und VRM im August 1954 wieder das erste Ausschreiben nach dem Krieg, die
Beuth-Aufgabe 1955 „Entwurf einer mit Gas betriebenen Turbinenlokomotive mit
energiewirtschaftlicher Vergleichsuntersuchung zu Diesellokomotiven”
veröffentlicht.
Mitte der 50er Jahre wurde eine Aktion für Mitgliederwerbung gestartet, die sich
besonders auf das Bundesgebiet erstreckte. Der Erfolg war nicht überwältigend. Es
fanden aber damals Fachgenossen zur DMG, die heute noch einen aktiven Kern
bilden.
Man erarbeitete auch eine neue Satzung und wählte am 22. Juni 1956 wieder
einen ordnungsgemäßen Vorstand, der sich zusammensetzte aus
|
| |
Karl Fischer
Gerhard Krienitz
Ernst Krull
Alfons Welz
Karl Roland
Wolfgang Harprecht
|
1. Vorsitzender,
Stellvertreter,
1. Schriftführer,
Stellvertreter,
1. Säckelmeister und
Stellvertreter. |
|
|
Am 4. Oktober wurde in bescheidenem Rahmen das 75-jährige
Jubiläum der DMG
gefeiert. Die Festveranstaltung fand im inzwischen neu errichteten Haus des
Akademischen Vereins Hütte e. V. in der Carmerstraße statt. In ihr wurde der
1. Vorsitzende Karl Fischer,
dem am 19. April 1951 von der Technischen Universität Berlin die Würde eines
Ehrensenators verliehen worden war, in Anerkennung seiner Verdienste um die DMG in
den schweren zurückliegenden Jahren zum Ehrenmitglied der DMG ernannt. Nur zwei
Jahre konnte sich Fischer dieser
Ehrung erfreuen. Am Fronleichsnamstag 1958 fiel er im Alter von 81 Jahren einem
Verkehrsunfall zum Opfer. In der folgenden Mitgliederversammlung wurde Dipl.-Ing.
Gerhard Krienitz zum
1. Vorsitzenden gewählt, 2. Vorsitzender wurde Dipl.-Ing. Walther
Sausse.
Nach einem Mitgliederverzeichnis vom Oktober 1959 hatte die DMG zu diesem
Zeitpunkt 72 Mitglieder, davon 32 in Berlin und 40 in der Bundesrepublik. Von
diesen 72 Mitgliedern waren 38 Altmitglieder, womit diejenigen gemeint sein
sollen, die schon vor 1945 der DMG angehörten.
In das Jahr 1959 fielen noch Ereignisse, mit denen die DMG begann, wieder in
stärkerem Maße an die Öffentlichkeit zu treten. Im Juli wurde von ihr die
Denkschrift „Elektrifiziert die Deutsche Bundesbahn – Eine
volkswirtschaftliche Aufgabe von großer Dringlichkeit” herausgegeben. Sie
wurde im Auftrag der DMG vom Ifo-Institut München zusammengestellt. Die Denkschrift
mit einer Auflage von einigen Tausend Exemplaren wurde breit gestreut und hatte
großen Erfolg.
Im Herbst des gleichen Jahres wurde in Berlin eine Tagung
„Dieselzugförderung” veranstaltet. Auf der international ausgerichteten
Veranstaltung hielten Fachleute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Frankreich vor zahlreichen Teilnehmern, auch aus der DDR, Vorträge über Stand und
Entwicklung des Dieselschienenverkehrs.
1959 konnte ferner im Rahmen des Beuth-Ausschreibens erstmals nach dem Krieg
wieder eine goldene Beuth-Medaille verliehen werden.
In den folgenden Jahren fanden in Berlin mehrere örtliche Veranstaltungen statt,
die in den meisten Fällen gemeinsam mit der Bezirksgruppe Berlin der Deutschen
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) durchgeführt wurden.
Parallel zur fachlichen Betätigung liefen umfangreiche und zeitraubende
Bemühungen um die Aufwertung des Vereinsvermögens. Die Arbeiten waren vor allem
dadurch erschwert, dass die wichtigsten Unterlagen aus der Zeit vor Kriegsende
vernichtet waren und nach 1945 die Vereinsangelegenheiten im Allgemeinen in
formloser Art erledigt wurden. Ende 1958 wurde auf Grund des Allgemeinen
Kriegsfolgengesetzes mit den Vorbereitungen für den Antrag begonnen, der dann
schließlich am 8. September 1960 von der Hausbank der DMG, der Berliner
Handelsgesellschaft, bei der Bundesschuldenverwaltung in Berlin gestellt wurde. Die
letzten angeforderten Unterlagen wurden im Januar 1966 und Dezember 1967 vorgelegt.
Im März 1968 erging an die DMG die positive Entscheidung mit 10 % Aufwertung
und 4 % Zinsen für die Zeit vom 1. April 1955 bis 31. März 1967. Aus
insgesamt 99.900 RM (DMG- und Stiftungsvermögen) wurden 10.100 DM +
4.981,53 DM Zinsen, also insgesamt rund 15.000 DM.
Die Aufwertung wirkte, wenn auch die finanziellen Auswirkungen für die Kasse der
DMG unbedeutend waren, da es sich im Wesentlichen um gebundenes Stiftungsvermögen
handelte, doch irgendwie wie eine belebende und regenerierende Spritze. Wenn auch
die Satzungen im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Änderungen erfahren haben, so
verlief das Leben der DMG, auch nach der Wiederbelebung Ende der 40er Jahre, doch
in den alten, traditionsgebundenen Bahnen. Man kam nun mehr und mehr zu der
Überzeugung, dass die DMG in ihrem Aufbau und ihrem Inhalt den geänderten
Zeitumständen angepasst werden sollte. Diese neue Zielsetzung fand ihren
Niederschlag zunächst in einer von Grund auf neu konzipierten Satzung, die in
Koblenz am 17. Oktober 1969 beschlossen wurde. Die wesentlichsten Unterschiede
gegenüber den alten Satzungen sind folgende:
|
| • |
Es wird nicht mehr zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern
unterschieden, sondern zwischen persönlichen und korporativen Mitgliedern; |
| • |
eine akademische Ingenieurausbildung ist nicht mehr Voraussetzung für die
Erwerbung der Mitgliedschaft, vielmehr ist Vorbedingung, dass der Antragsteller
auf dem Gebiet der Maschinentechnik tätig oder in der Lage ist, die Ziele der
DMG – die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Maschinentechnik,
insbesondere im Eisenbahnwesen, zu fördern und alle hierzu notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen – zu unterstützen; |
| • |
es gibt keinen „Säckelmeister” und „Schriftführer” mehr,
an ihre Stelle treten „Schatzmeister” und
„Geschäftsführer”; |
| • |
an die Stelle jährlicher Hauptversammlungen und dreijähriger Amtsdauer der
Vorstandsmitglieder treten Mitgliederversammlungen mit Neuwahl des Vorstandes
alle zwei Jahre; |
| • |
die Gemeinnützigkeit der DMG wurde wieder besonders herausgestellt; |
| • |
die regionale Gliederung wurde vorgesehen, wodurch in erster Linie dokumentiert
werden sollte, dass die DMG ihr besonderes Wirkungsfeld in der Bundesrepublik
Deutschland sieht; |
| • |
schließlich wurde die Satzung gestrafft, statt 25 Paragraphen enthält sie nur
noch 15.
|
|
|
Nachdem die DMG wieder über ein Stiftungsvermögen verfügen konnte, war es
angezeigt, dass auch die Stiftungsangelegenheiten neu geregelt wurden. Von der DMG
wurden nach wie vor die drei Stiftungen
|
| |
von Veitmeyer aus dem Jahre 1899,
von Wichert vom 20. Januar 1914 mit
Nachtrag vom 22. Februar 1921 und
von Müller vom 6. August 1917
|
|
|
verwaltet. Um die Stiftungsidee – die Förderung von jungen Studierenden
und Ingenieuren des Eisenbahnmaschinendienstes – auf einheitlicher Basis
wirkungsvoll fortsetzen zu können, regte der Vorstand die Zusammenlegung der drei
Stiftungen zu einer „DMG-Stiftung” an. Eine Änderung der jeweiligen
Stiftungssatzungen war möglich, da es sich um fiduziarische Stiftungen, also keine
rechtsfähigen Institutionen handelte. Ferner sind die Festlegungen der Stifter
hinfällig geworden, da die ursprünglich gestifteten Werte zum größten Teil durch
zweimalige Geldentwertung verloren gegangen und die Fonds zwischenzeitlich im
Wesentlichen aus Mitteln der DMG aufgefüllt worden sind. Die ausgearbeitete neue
Stiftungssatzung wurde vom Vorstand am 5. Mai 1972 beschlossen und durch
schriftliche Abstimmung im Mai 1972 von den Mitgliedern genehmigt. Die Satzung
bestimmt u. a.
|
| • |
Aus den Zinsen des Stiftungsvermögens können einmalige oder laufende Beihilfen
an Studierende des Maschinenbaufaches oder der Elektrotechnik gewährt und/oder Preise
für die Behandlung verkehrstechnischer oder -wirtschaftlicher
Aufgaben ausgesetzt und vergeben werden;
|
| • |
die Leitung der Stiftung obliegt einem Kuratorium.
|
|
|
In ihrem neuen Gewand verlegte jetzt die DMG den Schwerpunkt ihrer Arbeit nach
der Bundesrepublik Deutschland. Es wurden die Bezirksgruppen
|
| |
Nord mit dem Sitz in Düsseldorf,
Mitte mit dem Sitz in Frankfurt (Main),
Süd mit dem Sitz in München und
Berlin
|
|
|
gegründet, bei denen Vortragsveranstaltungen, Besichtigungen usw. durchgeführt
wurden. Ferner wurden ab 1969 die regelmäßigen Mitgliederversammlungen und
jährlichen Fachtagungen an wechselnden Orten in der Bundesrepublik Deutschland
abgehalten, um erst wieder 1981 aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Deutschen
Maschinentechnischen Gesellschaft mit einer Jahrestagung in Berlin aufzutreten.
Im Rahmen dieser Tagungen traf man sich 1971 in Mainz, wo Dr.-Ing. Dr.-Ing.
E. h. Günther Wiens (1901 bis
1975), langjähriges Mitglied des Vorstandes der DMG, in seiner Ansprache der
90. Wiederkehr des Gründungstages der Gesellschaft gedachte.
Auf der Tagung im Herbst des Jahres 1973, die in Würzburg stattfand und mit der
ein Treffen von Trägern der Beuth-Medaille verbunden war, wurde Dipl.-Ing. Karl
Kaißling, Ministerialdirektor
a. D., Träger der Beuth-Medaille, zu diesem Zeitpunkt seit 50 Jahren Mitglied
der DMG und viele Jahre Mitglied ihres Vorstandes, in Würdigung und dankbarer
Anerkennung seiner großen Verdienste um die Erhaltung und Förderung der
Gesellschaft zum Ehrenmitglied ernannt.
Die Herbsttagungen, bei denen auch gegebenenfalls die Preise des Beuth-Ausschreibens
bzw. -Wettbewerbes verliehen werden, stehen immer
unter einem bestimmten Motto, welches in mehreren Vorträgen namhafter Fachleute
aus Wissenschaft, Industrie und Verwaltung behandelt wird. Sie erfreuen sich
wachsenden Zuspruchs und sind inzwischen zu einer festen Institution im
herbstlichen Terminkalender geworden. Auch in gesellschaftlicher Hinsicht üben
die jährlichen Treffen eine große Anziehungskraft aus.
Die erwähnten Veranstaltungen der DMG und ihrer Bezirksgruppen wurden gemeinsam
mit der Vereinigung der Regierungsbaumeister des Maschinenwesens
„Motor” (VRM), später mit dem Fachausschuss Maschinen- und
elektrotechnischer Dienst (FME) der Vereinigung der Beamten des höheren Dienstes
der Deutschen Bundesbahn (VHB) durchgeführt, ebenso wie auch die Mitglieder der
DMG zu den Jahrestagungen der Vereinigung, die in der Regel in der Woche nach
Pfingsten stattfinden, eingeladen werden. Dieses auf die Anfänge des Vereinslebens
nach dem Krieg zurückgehende enge partnerschaftliche Verhältnis hat im Jahr 1980
noch seinen Ausdruck in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen DMG und VHB
gefunden, in der die freundschaftlichen Bande zwischen beiden Vereinigungen
bekräftigt wurden.
Ausblick
Wenn im 19. Jahrhundert die Entwicklungen auf technischem Gebiet einen
neuen Berufszweig, den Ingenieur, entstehen ließen und dieser, insbesondere der
Maschinentechniker, um die Zeit der Gründung der DMG um geregelte wissenschaftliche
Ausbildung und gesellschaftliche Anerkennung ringen musste, sind es 100 Jahre
später ganz andere, aber ebenso bedeutsame Probleme, die den Ingenieur
beschäftigen.
Zu den verantwortungsvollen Aufgaben eines Ingenieurs gehört in erster Linie,
durch Entwicklung technischer Mittel und durch ihre Anwendung die Lebensqualität
der Menschheit zu verbessern. Welche Bedeutung daher seinem Wirken und Schaffen in
der Zukunft zukommt, erkennt man, wenn man die sich für die nächsten Jahrzehnte
abzeichnende zahlenmäßige Entwicklung der Bevölkerung allein in der Dritten Welt
betrachtet. Sie wird in vier Jahrzehnten von 3 Mrd. auf 6,8 Mrd.
anwachsen und dann 82 % der Weltbevölkerung ausmachen. Der Ingenieur muss bei
der Erfüllung der ihm daraus erwachsenden umfangreichen und vielgestaltigen
Aufgaben verantwortungsbewusst vorgehen und darf nicht soweit gehen, dass er alles,
was machbar ist, auch ausführt. Er muss vielmehr wissen, dass die neue Technik auch
von der Gesellschaft beherrschbar sein muss und deshalb der technische Fortschritt
in immer stärkerem Maße von der Bereitschaft der Gesellschaft bestimmt wird, diesen
Fortschritt auch anzunehmen. Der Ingenieur muss daher den ohne Zweifel unumgänglich
notwendigen, technischen Fortschritt im Rahmen der gesellschaftlichen
Fortentwicklung in wirtschaftlicher, politischer, kultureller und ethischer
Beziehung sehen und sich seiner Aufgabe als Wahrer eines echten technischen
Fortschrittes zum Wohle der Menschheit bewusst sein. Von ausschlaggebender
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass der Ingenieur bereit ist und es versteht,
mit seinem Sachverstand, aber in allgemein verständlicher Form, die Öffentlichkeit
über technische Zusammenhange zu informieren. Er muss damit dazu beitragen, dass
falsche Vorstellungen und Missverständnisse abgebaut werden.
In einer Zeit wie heute, in der so manche negative Auswirkung des technischen
Wachstums festgestellt werden muss, erwächst der DMG für die Zukunft u. a.
die wichtige Aufgabe, zu einer fachgerechten und nüchternen Beurteilung der
Situation ohne jede Emotion beizutragen. Neben den bisher mit Erfolg durchgeführten
Maßnahmen auf dem Gebiet der Nachwuchsförderung und der praxisnahen Weiterbildung,
vor allem auch in interdisziplinärer Hinsicht, wird sie durch ihre Organe und die
satzungsgemäß festgelegten Maßnahmen zur Erfüllung der Gesellschaftsziele ihren
Anteil zu einer internen und externen Information über die Technik und ihre
Neuentwicklungen beisteuern. Sie wird ferner die Gewissheit zu dokumentieren haben,
dass der Ingenieur kein reiner Technokrat, sondern sehr wohl in der Lage ist, die
Folgen seiner Entwicklungen für die Allgemeinheit abzuschätzen.
Die umfangreichen und für unser Zusammenleben so wichtigen Aufgaben sind
allerdings nur von einem Ingenieurkorps zu meistern, das sich einer fundierten
Ausbildung und Allgemeinbildung erfreut und mit Begeisterung sich der Lösung der
anstehenden Probleme widmet. An der Bildung eines solchen Korps mitzuwirken, wird
eine weitere Aufgabe der DMG in den kommenden Jahrzehnten sein. In diesem
Zusammenhang wird in den Vordergrund zu stellen sein, dass es auch in der heutigen
Gesellschaft erstrebenswert ist, den Ingenieurberuf zu wählen, um im oben
geschilderten Sinn in einer an interessanten Aufgaben reichen Zukunft wirken zu
können. So erstreckt sich, vorausschauend in die Anfänge des zweiten Jahrhunderts
der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft, ein weites Feld für die
Fortsetzung ihrer segensreichen Betätigung.
G. Krienitz
|
| |
 Der nachfolgend
wiedergegebene Aufsatz von Krienitz
erschien in der von der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG) 1981
anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens als „bescheidenen Beitrag zur
Technikgeschichte” herausgegebenen Festschrift. Er ist eine überarbeitete
Fassung der etwas umfangreicheren Veröffentlichung
Der nachfolgend
wiedergegebene Aufsatz von Krienitz
erschien in der von der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft (DMG) 1981
anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens als „bescheidenen Beitrag zur
Technikgeschichte” herausgegebenen Festschrift. Er ist eine überarbeitete
Fassung der etwas umfangreicheren Veröffentlichung Das 19. Jahrhundert]
Das 19. Jahrhundert] Der Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure 1881 bis 1920]
Der Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure 1881 bis 1920] Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 1920 bis
1945]
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft 1920 bis
1945] Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft
1945 bis 1981]
Die Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft
1945 bis 1981] Ausblick]
Ausblick]